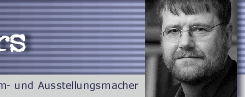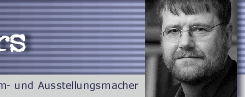|
Nachwort
Nach 30 Sekunden Film
oder drei Seiten Buch muß das erste Opfer auftauchen.
So lautet das ungeschriebene Gesetz des Krimihandwerks. Je
grausamer die Leiche verstümmelt, je mehr Blut fließt
und Schüsse fallen, desto größeren Erfolg
hat das Machwerk beim Massenpublikum.
Nicht so die vorliegende Kriminalgeschichte, an der wohl auch
nur eine Minderheit von Lesern ihren Spaß haben wird.
Aber was für einen! Vordergründig geht es in der
bizarren Geschichte, die ein Journalist einer kunstsinnigen
Runde, erst im Gasthaus einer Rheinstadt, dann in einem Chemnitzer
Weinkeller zum Besten gibt, um die Jagd einer chinesischen
Geheimgesellschaft nach dem Urteller des Meißner Zwiebelmusters,
das, wie kann es anders sein, aus China stammt. Berlin und
Venedig sind die unmittelbaren Handlungsorte. Es gibt Schüsse,
Tote und ein wenig Blut.
Doch das ist nur die Oberfläche. Die eigentliche Reise,
zu der uns dieser Text einlädt, findet im Kopf statt
und führt in die Untiefen der Kulturgeschichte von Mexico
über China und das alte Europa bis ins verwirrende Chaos
unserer Tage hinein. So entpuppt sich der Krimi als raffiniert
verpackte Wundertüte für Erwachsene: eine Schachtel
voller Schachteln, aus denen wieder andere zutage treten.
Legt man sie nebeneinander, ergibt sich ein Puzzle: ein Bild
unserer Welt. Der Verfasser dieses Puzzles, Friedrich Dieckmann,
wurde 1937 in Landsberg/Warte geboren. Er hat Germanistik,
Philosophie und Physik studiert und von 1972 bis 1976 als
Dramaturg am Berliner Ensemble gewirkt, bevor er Schriftsteller
und Kritiker wurde. Neben Büchern über Schiller,
Schubert, Brecht und Wagner schrieb der Altmeister des Essays
einen Band zur deutschen Oper.
Von dieser Bildungsbreite und -dichte lebt auch die Geschichte
über die Blaumalerei. Ein Lesevergnügen, das die
Zeichnungen von Horst Hussel zum Genuß steigern. 1934
in Greifswald geboren, wurde Hussel gleich zweimal, an den
Kunsthochschulen in Dresden und Berlin, wegen „Formalismus“
und „Dekadenz“ exmatrikuliert. Davon unbeirrt
ging er seinen eigenen Weg, entwickelte er seit 1961 eine
unverkennbar eigene Handschrift als Grafiker, Buchgestalter,
Schriftsteller und Herausgeber.
Hussel bevorzugt das Groteske, das Skurrile, doch nicht um
des Auffallens willen. Er liebt die Außenseiter, die
um unverfälschten Ausdruck ringen. Wie Kinder, die noch
nicht die Kunst beherrschen, sich hinter gängigen Mustern
zu verstecken. Daher das scheinbar „Kindliche“
seiner Zeichnungen, das in Wirklichkeit nur von der „Disziplin“
zeugt, das Gesehene „auf wenige Stufen“, aufs
Wesentliche, „zu reduzieren“, wie Paul Klee dieses
Verfahren nannte, das uns immer wieder staunend erfreut.
Pressestimmen
Der Essayist Friedrich Dieckmann
... wagt mit »Blaumalerei« einen ebenso überraschenden
wie gelungenen Ausflug ins damit von ihm sofort neu (nämlich
philosophisch) definierte Genre der Kriminalgeschichte. Mitsamt
Horst Hussels hinreißend kryptischen Zeichnungen wird
auch dieser Text dann zum Exempel auf die Möglichkeitsform:
Ermittlung in eigener Sache.
Gunnar Decker, in: Neues Deutschland, 3. Juni 2015
Horst Hussel illustriert nicht, er illuminiert. Nach
eigener Licht-, nein Leuchtgesetzgebung. (...)
Dieckmanns Text zieht hinaus, unterm Diktum eines bizarren
Falles um kostbarkeitsbesessene Mafiosi; ja, das Thema steht
fest, aber dann wird rasch ein Auszug ins Freie daraus, nicht
etwa ins Ungebundene, jedoch ins Höhere oder Tiefere,
ins Raumzeitliche, das keine banalen Unterscheidungen zwischen
Erzählung und Essay anstellt. Bemerkungen zur chinesischen
Mauer weiten sich zum Sinnieren über das grundsätzliche
Elend betonierter, steinerner Abgrenzung. Fabuliert wird über
„eine Revolution, die man Restauration nannte“,
was Assoziationen weckt zur Restauration, die in manchen Mündern
Revolution heißt. Und höchst aufstörend setzt
Dieckmann den Studentenaufstand 1989 auf dem Platz des Himmlischen
Friedens ausholend in historische Kontexte und schlussfolgert:
„China in der Hand einer überseeisch gelenkten
Jugendbewegung – das hätte Chaos und Blut in weit
größerem Maßstab bedeutet.“
Dieckmann zu lesen, ist eine Arbeit, also: eine wahre Vergnügung,
die etwas kostet, um sich auszuzahlen. Denn des Autors Denken,
das Sprache wird, wehrt sich gegen das Geläufige der
schnellen Begriffsreihungen, die dem Gemüte Anstrengung
vermeiden. Da ist Intensität und Reichhaltigkeit –
eingefangen im kleinen Geschichtenraum: der große Geschichtsraum.
Abenteuer Sprache. Allein im Freigeist findet’s wirklich
statt. So flaniert Dieckmann, dichtend, durch die Zeiten,
heiter und hingebungsvoll im Skeptischen. Ein Spaziergänger
durch Sphären des Politischen und Sozialen, deren Enge
ihn doch insofern beglückend anfällt, weil gerade
das Beschädigte, das Unvollendete eine treibende Medizin
ist für Erweiterungen des kritischen Bewusstseins. Dieckmann
verfügt über eine scheu-filigrane Erscheinungsart,
die leicht darüber hinwegzutäuschen vermag, dass
es sich bei ihm um einen Besessenen handelt. Seine schriftfixierte
Existenz ist so sehr von Ausdrucksgabe und Sinntiefe genährt,
dass sie, Text geworden, vom Leser als Erfahrung wahrgenommen
wird und nicht als deren Ersatz stolziert. Er lebt sein Schreiben,
es lebt ihn. So empfangen beide voneinander: Stütze.
In der Unermüdlichkeit dieses Autors geht das hervordrängend
Enzyklopädische eine Bindung ein mit geschliffenstem,
hageldicht differenzierendem Wort; ganz Liebe zu stilvoller
Komplikation. Das hebt an, das hebt sich ab, das ist hochdiszipliniert
– wer Dieckmann liest, erlebt Freiheit gegenüber
jeder Form (Nicht-Form) obwaltender Vokabularherrschaft.
Hans-Dieter Schütt, in: Palmbaum, Heft 2/2015
... ein Krimi, der aufs Geistige
zielt – aufs Staunen und Bedenken.
Irmtraud Gutschke, in: Neues Deutschland, 15. Oktober
2015
|
 |