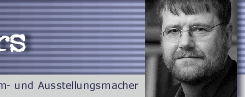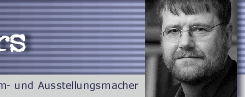|
Aus dem Nachwort
Ein Mann, dessen Texte die Leserschaft
spalten: die einen bewundern ihn als brillanten Stilisten,
die anderen verachten einen Saulus, der sich zum Paulus gewendet
habe. Liebe oder Hass, ganz oder gar nicht. Das ist Hans-Dieter
Schütt: 1948 in Ohrdruf, am Rand des Thüringer Waldes
geboren, Gummifacharbeiter, Buchhändlerlehring, Student
der Dramaturgie und Theaterwissen-schaften, seit 1973 Filmkritiker
der Jungen Welt, von 1984 bis zum Wendeherbst Chefredakteur
dieser Jugendzeitung der DDR. Zugleich Sekretär im Zentralrat
der FDJ, ein Agitator, Einpeitscher der Staatsdoktrin?
So führt ihn Wikipedia noch heute vor, jenes Zeitgeistlexikon,
in dem jeder mitschreiben kann, aber nur wenige im Verborgenen
entscheiden, was veröffentlicht wird: als „Feingeist
und Scharfmacher, ‘kurz: ein Demagoge’“.
Man zitiert einen Rezensenten von Schütts Autobiografie
Glücklich beschädigt (2009), nicht den Autor selbst;
fixe Urteile werden abgeschrieben und als Wahrheiten verbreitet,
statt die Leser zu ermutigen, sich ein eigenes Bild zu machen,
die Dinge mit eigenen Augen zu sehen. Dabei hatte Schütt
in dem Buch praktiziert, was andere fordern: Aufarbeitung
von Geschichte als dem, was mit und durch uns selbst geschieht.
Und das nicht nur in diesem einen, in all seinen mehr als
30 Büchern, die er seit der Wende schrieb, in Biografien,
Essays und Gesprächen fragt er sich und sein Gegenüber
nach dem anders Möglichen jenseits gängiger Karrieren.
Die Wende, der Absturz vom Chefredakteur der zweitgrößten
DDR-Tageszeitung zum Nichts, zum vogelfreien Journalisten,
der neu beginnen muss, hat auch ihn befreit, sein Denken und
Sprechen von verinnerlichten Zwängen entbunden. Neben
seinen Büchern zeugt das Feuilleton des Neuen Deutschlands
davon, in dessen Redaktion Hans-Dieter Schütt von 1992
bis 2012 gearbeitet und den Wandel des einstigen Parteiorgans
zu einer streitbaren linken Tageszeitung maßgeblich
mitgeprägt hat.
Manche lasen das Blatt nur seiner Kritiken, Glossen und Essays
wegen. Eine Auswahl vereint dieser Band: Porträts von
Regisseuren, Schauspielern und Schriftstellern, von Grenzgängern
und Abenteurern, ein längst überfälliges Loblied
auf alle Statisten und Nebendarsteller, Überlegungen
zum Erfolgsgeheimnis von Chaplin und Donald Duck bis hin zu
einem kleinen Versuch über das Licht.
Immer wieder geht es um die Schärfung unserer Wahrnehmungen,
um das genauere Lesen, Hinsehen und -hören. Den Unbedingten,
den Brennenden, die sich in ihrer Arbeit verzehren und stets
neu erfinden, gilt Schütts Augenmerk, deren Lebensgesetze
versucht er in ihren je eigenen Widersprüchen zu ergründen.
Vielleicht war für solch einen lebendigen Blick gerade
das befreiende Scheitern im eigenen Leben vonnöten. Während
Siegen verdummt, wie Nietzsche den Deutschen schon 1871 ins
Stammbuch schrieb, nötigen Niederlagen zur Neuorientierung.
Wer nicht gleich wieder neuen Fahnen folgt, hat die Chance,
sich aus selbstverschuldeter Unmündigkeit zu lösen,
wie Kant einst Aufklärung definierte.
Freilich gab es in der DDR auch wache Geister, die schon immer
die Distanz zur Macht gewahrt haben. Leben und Werk von Hans
Ticha stehen dafür exemplarisch: 1940 im böhmischen
Tetschen geboren, wuchs er in Schkeuditz auf, studierte Pädagogik
in Leipzig und, nach kurzem Lehrerdasein, Kunst in Berlin-Weißensee.
Seit 1970 ist Ticha freischaffender Maler und Grafiker, bis
1990 im Prenzlauer Berg, danach in Mainz und seit 1993 im
Hessischen Maintal. Er galt – neben Wasja Götze
– als der Pop-Künstler der DDR, weil seine Vorliebe
zu den bunten Farben und plakativen Figuren der Pop-Art von
Anbeginn auffielen. Kenner der Kunstgeschichte verweisen auf
Fernand Léger, Bauhausmaler wie Oskar Schlemmer und
die russischen Konstruktivisten als seine Vorbilder. Doch
wirklich erkannt ist damit nichts. Wie ein guter Schriftsteller
seine Vorgänger nicht zitiert, um die eigene Bildung
auszustellen, so nimmt ein Maler keine Anleihen bei den Großen
der Zunft, um sich damit zu schmücken. Tichas Beitrag
zur Pop-Art ist ganz und gar eigenständig: während
Warhol & Co im Westen die schrille Werbewelt in Kunst
transformierten, spielte Ticha mit der Werbung des Ostens
– den Verheißungen der Propaganda: „Reflexionen
der Selbstdarstellung der Herrschenden“ nennt der Maler
seine Bilder.
Aber nicht nur die Herrschenden erscheinen darauf als entindividualisierte,
stromlinienförmig angepasste Leiber mit kleinen Köpfen,
jedermann, auch die Beherrschten, die sich frei dünken,
werden als Marionetten an unsichtbaren Fäden kenntlich.
Vor und nach der Wende. Und dies wiederum nicht im Gestus
bierernster Entlarvung, sondern immer mit einem Lächeln:
keine Häme, die nur andere in ihrer Schwäche zeigt,
sondern ein befreiendes Verlachen des menschlich Allzumenschlichen.
Das unterscheidet ihn von vielen, die sich heute ihrer einstigen
Dissidenz rühmen: dass er nie nur Rechthaben wollte und
zur Gegenwart nicht schweigt. So auch in diesem Buch: Da steht
am Anfang ein Eintrichterer, der mit dem Kampfgruß der
geballten Faust sein Gegenüber hypnotisiert. Gefolgt
vom nackten Mann als Kräfteschema und einem namenlosen
Artisten, der als Alleskönner durchs Leben radelt –
wie wir alle.
Und das verbindet die Grafiken mit den Texten: in beiden verdichten
sich präzis geschärfte Wahrnehmungen.
Leseprobe
Charlot: Der Luftmensch
Das ist und bleibt Charlot: der unsterbliche, kleine, schmächtige
Mann. In diesen zu weiten Hosen, in deren Taschen so viele
Tragödien Platz haben.
In diesen zu großen Schuhen, in denen er über sich
selbst stolpern kann. In dieser zu großen Welt, in der
er die Verlassenheit des Einsamen atmen muss, aber auch den
Stolz des Außenseiters hervorkehren kann. Chaplins Charlot
ist vielerlei. Er ist der Dandy als Vagabund, der Vagabund
als Dandy, und von beidem auch gleich noch die Parodie. Ist
aber auch die Inkarnation des beliebigen Mannes von der Straße:
Die Melone soll ihm Würde verschaffen, der Schnauzbart
demonstriert seine Eitelkeit; der Veston, das Stöckchen
und seine Manieren wollen auf einer Wolke von Illusion den
Eindruck von Galanterie begründen. Auch von Draufgängertum.
Denn Charlot, im kecken, koketten Wiegegang, möchte vor
der Welt bestehen, er will sie düpieren und sich zugleich
selbst bemitleiden. Das Selbstmitleid macht ihn schöpferisch:
Damit hat er Millionen Menschen zum Lachen gebracht. Nach
dem Gesetz des Bruders Beckett: bis zum Äußersten
gehen, dann wird Lachen entstehen. Auch wenn es oft nur der
sehr bittere Spaß ist, in den alle Wege führen.
Aber Charlot ist eine noch weit schwierigere Figur. In ihm
hat Ahasver, der herumirrende Jude, ebenfalls Gestalt angenommen;
er ist der Luftmensch, der Entwurzelte. Er will glücklich
sein und überlebt deshalb alle Katastrophen. Aber er
liebt seine Katastrophen, auch wenn er unglücklich ist.
Charlot ist gleichzeitig diebisch und ehrlich, ängstlich
und tapfer, aber es steckt vor allem auch die Bösartigkeit
der Schwachen in ihm. Denn die sind oft am wenigsten gut,
sie können es sich nicht leisten. Im Grunde ist er ein
Kind, und zum Kind gehört, dass es kein Mitleid hat.
Am Schluss des Filmes Modern Times sehen wir ein Paar von
hinten, schon wird es eingekreist vom Schwarz der sich schließenden
Kameralinse: die Wunderschöne mit luftigem Kleid und
elegantem Hut. Daneben er, der Watschel, und so arg kleiner
als sie. Da feiert die Unwahrscheinlichkeit einen Triumph,
von der wir im Leben so vergeblich fantasieren: Wer findet
schon seinen Traumpartner! Die Schluss-Szene zeigt, dass da
ganz locker zusammengeht, was nicht zusammengehört. Und:
Diese zwei, in ihren Äußerlichkeiten so krass auseinanderstrebenden
Menschen tun nichts, um einander passend zu machen. Just das
zu leben, was ist; nicht aber das, was nur zu scheinen hat,
als ob es wäre - vielleicht die gütigste aller Botschaften.
Doch lediglich im Film ist das Glück dann wie ein Singvogel,
man malt ihn an die Wand und horcht dem ungeborenen Zwitschern
nach.
Pressestimmen
Hans-Dieter Schütts
Essays »Draußen daheim. Wahrnehmungen« umkreisen
schreibend das, was der Autor tagtäglich lebt, seine
innere Haltung zu allem Außen. Das Welttheater des Wortes!
Etwas herbeirufend, das unter dem brachialen Griff der Ideologen
sofort erstürbe: eine Gegenwelt des Geistes. Essays sind
im Sinne Mörikes Selbsthelferversuche inmitten einer
zunehmend fremd werdenden Welt, aber darum keineswegs frei
von Zwecken, nur liegen diese im Hintergründigen.
(...) Wer mit Vergangenheit so beladen ist wie Schütt,
der bremst, sperrt sich mit allem, was er an Worten hat gegen
die Wiederkehr des erkannten Grundirrtums nicht nur des eigenen
Lebens, auch der sozialistischen Bewegung: das Gefügigmachen
von dem, was nicht ins eigene Konzept passt.
Schütt hat kein Konzept, darum lohnt es überhaupt
erst, ihn zu lesen, was immer auch Provokation zum Anderswerden
bedeutet, das Betreten neuer Räume, auch wenn man dann
plötzlich draußen vor der Tür steht: Immerhin
nun im Freien! Die drei Holzschnitte von Hans Ticha (in der
Vorzugsausgabe mit einem signierten Original) bringen das
Thema »Artist« auf jenen Archetypus, wie er zwischen
Höhlenmalerei und Ampelmännchen seit jeher den Spagat
zwischen Ritus und Gebrauchsdesign probt.
Gunnar Decker, in: Neues Deutschland, 3. Juni 2015
|
 |