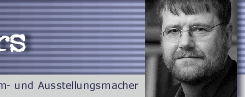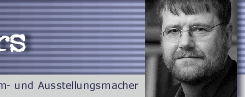Aus dem Nachwort
Ich wette: in einem seiner
Leben war er ein Altberliner Droschkenkutscher. Und davor
irgendwann ein Landsknecht, der den Tod verlachend ins Gemetzel
zog, und in noch früherer Zeit ein Zen-Priester in Fernost.
Von alledem sprechen die Gestalt und die Gestalten des Wilhelm
Bartsch, dessen jüngste Wiedergeburt sich 1950 in Eberswalde
ereignet hat. Rinderzüchter wurde er nun, Philosophiestudent
in Leipzig, Korrektor und Rotationsarbeiter in Chemnitz, als
es Karl-Marx-Stadt hieß, Dramaturg und Heimerzieher,
Postfacharbeiter und Nachtwächter in Halle an der Saale,
wo er seit 1976 lebt und seinem Brandenburgischen Dialekt
treu bleibt.
(...) Übungen im Joch nannte er im seinen ersten Gedichtband.
Das war kein Kampfruf, kein Aufschrei, ein politisches Joch
abzuwerfen. Nicht Prometheus oder Ikarus sind seine Helden,
nicht die Lichtbringer und Himmelsstürmer, die glauben,
ein spektakuläres Fanal könne die Welt verändern,
sondern die Sisyphose des Alltags, die ihren Stein geduldig
wälzen, die sich mit ausdauernder Kraft und Witz ins
Joch spannen, um den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Ganz
und gar irdisch sind denn auch seine Verse. Nicht luftig leicht
kommen sie daher, erdenschwer, sinnlich direkt bis zur Derbheit,
und doch poetisch dicht in eindrucksvollen Bildern, die sich
festhaken und hängen bleiben. Wie die Erinnerung an den
Großvater, der den Enkel auf dem Gepäckträger
seines Wanderer-Damenfahrrads in die Welt bugsiert, „ein
lebendiger Fels“, in dessen Rücken auch wir, die
Leser, an den Entdeckungen des Wilhelm Bartsch Anteil nehmen
dürfen. (...)
Zeigt sich die Heiterkeit und der Witz dieser erdgebundenen
Verse oft erst auf den zweiten Blick, so scheinen umgekehrt
die farbenfrohen Zeichnungen des Malers Moritz Götze
von einer sorgenfreien Welt zu künden: ein ewiges Fest,
knallig bunt unter strahlend blauem Himmel, wie die Werbung
sie uns verheißt. 1964 als Sohn eines Malers und einer
Teppichweberin geboren, war Götze Gitarrist und Sänger
in Punkbands, hat Möbeltischler gelernt, statt Kunst
zu studieren, und arbeitet seit 1985 in einer eigenen Grafik-Werkstatt
mit den Mitteln der Popart: schrill, plakativ und raffiniert.
Die Technik des Siebdrucks hat er zu neuer Perfektion gesteigert,
seine keramischen Mosaiken und Emaille-Arbeiten erobern den
öffentlichen Raum, seine Formensprache ist unverkennbar
und wirkt selbst schon stilbildend.
Zeitgemäß nennen manche die Kunst des Moritz Götze
und meinen, sie sei so oberflächlich wie das Konsumzeitalter.
Doch verwechsle man den Boten nicht mit der Botschaft. Haben
sie denn eine, diese Bilder, die nur eine Oberfläche
fixieren? Ein reines Farbenspiel für die Sinne ohne Sinn
dahinter oder darüber hinaus, ohne Perspektive, alles
bewegt und erstarrt zugleich, Menschen wie Dinge vereinzelt,
beziehungslos, Atome, schwebend im luftleeren All, gehalten
nur durch schwarze Linien, die sie umranden wie Traueranzeigen?
Melancholisch ist die Heiterkeit dieser bunten Bilder, die
nicht lügen, indem sie unsere Lüge festhalten: den
Himmel auf Erden in paradiesischer Endzeit.
Der denkbar schönste Kontrapunkt zu Wilhelm Bartschs
Gedichten: poetische Welterkundungen in Wort und Bild.
Leseprobe
Die alte Marke Wanderer
Mein Großvater
schnallte das Kissen auf den Gepäckträger
des „Wanderer“-Damenfahrrades, er sagte: Nun schwing
dich
hinauf! Es war ein rußschwarzes Klettergerüst
hoch zum Fahrtwind, ein Eisenzeitmonster, ein Sicherheitsnetz
überspannte das Hinterrad noch und verkleidet waren
mit Blech die krachenden Ketten, der Lenker war mächtig
wie Auerochshörner, man radelte aufrecht den Wind an
auf den kleinen Weltreisen. Denn immer, wenn Großvaters
Baß
sich lauthals erleichtert hatte im Chor der Altlutheraner
am Tage des Herrn - fuhr er mich stets durch Himmel und Hölle
der Welt. - Heut zeig ich dir Wasser, Wilfried! so sprach
er
zum Beispiel, das fließt von unten nach oben! –
Ich liebte
den Springquell voll märkischem Blutsand als Edelsteinwäsche
und nasses, stummes Feuerwerksspiel. Wir stiegen
oft ab, ich liebte die Bunker so bleich, die Knochen so grün
und Rost und geschwärzte Mauern in Kuckuckslichtnelken,
den Eisendrahtstumpf in den Kuscheln, den Großvaterfreund,
dem links in der Tasche sein eines Hosenbein und da drin,
unendlich gespiegelt in sich, die Henry-Milchbonbonschachtel
stets steckte. Vor mir steht oft wie ein Knacken des Rücktritts
die Kindheit, von Halt zu Halt mit dem „Wanderer“
urbi
et orbi. Und wie ein lebendiger Fels wogt noch vor mir
der gewaltige Großvaterhintern, ich hielt mich und strippte
die wogenden Stahlfederzitzen da unterm Sattel.
Und wie stahlblaue Milch scharf am Eimerrand klingelt,
so molk ich die Welt, von einem Ort zu dem andern,
und Großvater butterte zu mit kurbelnden Füßen.
Pressestimmen
Das Titelstück steht am
Anfang und ist ein Großvater-Gedicht, mit viel echter
Liebe und ohne falsches Pathos geschrieben. Es gehört
zu der Abteilung Uckermärkische Gedichte. Alle lyrischen
Texte hat Bartsch nach Landschaften geordnet, die mal mehr
und mal weniger real sind, die er selbst bereist oder lesend
erkundet hat. Also radeln wir mit ihm durch den tiefen Sand
der Mark, setzen mit dem Schiff über auf die Greifswalder
Oie, begreifen die Kathedrale zu Bari und lassen uns das Wendland
zeigen.
Illustriert werden Bartschens so wunderbar erdenschwere und
doch alles andere als hermetischen Verse von den luftig-leichten
und popart-bunten Zeichnungen des halleschen Künstlers
Moritz Götze
Kai Agthe, in: Palmbaum. Literarisches Journal aus
Thüringen, Heft 1/2012
Einer der bedeutendsten deutschsprachigen Lyriker
seiner Generation. Und nach wie vor aufs Anregendste unabkömmlich
in Mitteldeutschland, wo der Wilhelm-Müller-Literaturpreisträger
als Sekretär der Klasse für Literatur und Sprachpflege
der Sächsischen Akademie der Künste in Dresden vorsteht,
der einzigen ostdeutschen Akademie ihrer Art.
Aufs Anregendste unabkömmlich: Das trifft auch auf diesen
bibliophil gestalteten, mit den wie in Zigarettenbilder-Manier
eingeklebten Reproduktionen farbiger Moritz-Götze-Zeichnungen
ausgestatteten Band zu .... Ein Büchlein in der Anmutung
der Quarthefte aus dem Wagenbach-Verlag. Aufs Anregendste
unabkömmlich aber vor allem, weil sich Bartsch in seinem
neuen Lyrikband keinerlei Zügel anlegt. Querfeldein zieht
der 61-Jährige in zehn Abteilungen durch seine Landschaften:
von der Uckermark aus an die Ostseeküste, durch das Wendland,
Irland, Italien, Amerika, das äußere und innere
Deutschland. Jahresringe einer Dichterbiografie, die man gerne
sieht. Denn in den besten seiner neuen Gedichte zeigt sich
Bartsch so frisch und frei wie in seinem bis heute ganz unverbrauchten
Debüt "Übungen im Joch" von 1986. Vergnügen
und Freiheit: Das teilt sich mit. (...)
Großartig ist Bartsch, wenn er nah und seelenruhig an
der Landschaft schreibt und an der eigenen sinnfälligen
Erfahrung. (...) Die alte Marke Wanderer: Das meint die liegen
gebliebenen Fortschrittsgerätschaften der Menschheit
genauso wie die auf ihrem jeweils eigenen Weg gebliebenen
Landsleute, das ist der Dichter genauso wie sein Leser, den
Bartsch in der Nachbemerkung "Meine Poetologie"
als "nach-lesenden Dichter" begreift, als einen,
der bei der Lektüre das Gedicht fortschreibt.
Christian Eger, in: Mitteldeutsche Zeitung
So wie die Landschaften wechseln, so wechselt
auch die Gestalt des Dichters, ohne sich je zu maskieren.
Es ist etwas Protheisches in den Gedichten Bartschs; das lyrische
Ich erscheint in jedem Gedicht ein wenig anders, denn "jedes
gute Gedicht trägt wie ein Vexierbild seine ganz eigene
Poetologie schon in sich". Die Gedichte verändern
sich beim mehrmaligen Lesen, wenn die Oberfläche des
lyrischen Gebildes durchstoßen ist und sich Melancholie,
Heiterkeit und Witz des Gedichtes erschließen. In diesem
Sinne korrespondieren sie mit den Zeichnungen des Hallenser
Malers Moritz Götze, die unsere "schöne, neue
Welt" in knallbunten Farben zeigen und erst nach mehrmaligem
Betrachten ihren hintergründigen Humor preisgeben. Für
Bartsch heißt gute Gedichte zu schreiben, es zuzulassen,
dass die "Schönheit mit den unmöglichsten Galanen
tanzt" (Pablo Neruda).
Dietmar Ebert, in: Thüringische Landeszeitung
(TLZ)
Erfrischende Gedichte, die immer auch reale Verortung
brauchen, erwarten uns. Und dass eine Widmung auf Seite 42
an Volker Braun geht, kann auch nicht verwundern, erblickt
der Rezensent hier in den Texten und Biografien eine Verbindungslinie.
(...) Die Sätze zur Poetologie im Nachtrag des Bandes
treffen tief, zum Mitmeißeln geeignet. Fünf Zeichnungen
von Moritz Götze sind beigefügt, stehen als Kontrast
und doch passend ....
Thomas Ernest, in: Ostragehege, Heft 1/2013, Nr. 69,
Dresden
Bartschs Gedichte bilden eine Art Autobiographie in Lebenslandschaften
ab. (...)
„Bartsch ist eine seltsam originäre Begabung“,
schreibt Kollege Manfred Jendryschik über ihn. „Ein
intellektuell kontrolliertes Eintauchen in die Geschichte,
ein Kennen aller möglichen Wunden und gleichzeitig der
vital-plebejische Grundgestus, daß die Worte aus den
Nähten zu platzen scheinen.
Klaus Seehafer, auf: www.alliteratus.com
Wie Provinz sich in Welt ausdehnt und Weltorte als
poetische Provinz besiedelt werden, demonstriert Wilhelm Bartsch
in kraftvollen Gedichten. ... Landschaften werden im Ineinander
von Früh- und Spätgeschichte erlebt, von Mythos
und Alltag. Dem Band sind popartige Farbzeichnungen von Moritz
Götze beigegeben, die jene höhere Naivität
des Lust-Spiels andeuten mögen, das Lyrik auch bedeutet.
Jürgen Engler, in: Marginalien. Zeitschrift für
Buchkunst und Bibliophilie, Heft 3/2013
Was die Stärke der lyrischen
Stücke von Wilhelm Bartsch ausmacht, das ist die urwüchsige
Sprache, sind die muskulösen Metaphern, bleiben die burschikosen
Bemerkungen, die sich in noch einem jeden Text zu derben bis
deftigen Sinnbildern fügen. Diese Art Lyrik ist so ziemlich
einmalig, ist bauernschlau und feinsinnig zugleich. (...)
Dieser Dichter ist kein Stein-, er ist ein Wortmetz.
Michael Ernst, in: Signum, 2013.
|
 |